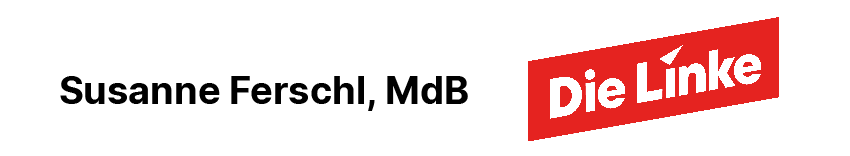Gastbeitrag von Susanne Ferschl, zuerst erschienen in „der Freitag“
Weniger Lohn für gleiche Arbeit gehört zur Realität von Leiharbeitern in Deutschland. Ermöglicht hat das die SPD. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshof könnte mit dieser Praxis Schluss machen.
Leiharbeit ist und bleibt prekäre Beschäftigung. Bereits die Grundkonstruktion erschwert individuelle und familiäre Zukunftsplanung, weil Leiharbeitende heute hier und morgen dort eingesetzt werden können. Dass aber ein Großteil der betroffenen Beschäftigten einen Verdienst unterhalb der Niedriglohnschwelle hat, ist vor allem Schuld der tariflichen Öffnungsklauseln im Leiharbeitsgesetz. Sie hebeln den Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ aus. Die rechtliche Problematik dieser Klauseln wurde nun in einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) bestätigt: Eine Ungleichbehandlung bei der Vergütung sei konkret durch Ausgleichsvorteile bei der Arbeitszeit (etwa durch mehr Urlaub) auszugleichen. Doch anstatt endlich klare Verhältnisse zu schaffen und die Öffnungsklauseln ein für alle Mal zu streichen, spielt die Bundesregierung auf Zeit. Wo bleibt hier der im SPD-Wahlkampf viel beschworene „Respekt“ vor den Leiharbeitsbeschäftigten und ihrem Recht auf einen fairen und auskömmlichen Lohn?
Am 15. Dezember des vergangenen Jahres erfolgte der Paukenschlag durch den EuGH: Das Gericht urteilt, dass Leiharbeitsbeschäftigte per Tarifvertrag nur dann weniger verdienen dürfen als direkt vom jeweiligen Unternehmen angestellte Beschäftigte, wenn ihnen dafür ein anderer wesentlicher Ausgleich gewährt wird, etwa deutlich mehr Urlaub oder kürzere Arbeitszeiten. Dieser Rechtsspruch zieht weitreichende Konsequenzen nach sich, denn die für die Leiharbeit geltenden Tarifverträge sehen durch die Bank keinen Ausgleich für die niedrige Entlohnung der betroffenen Beschäftigten vor. So gut wie alle Leiharbeitskräfte in Deutschland arbeiten damit unter europarechtswidrigen Bedingungen. Doch aus Berlin ist seit der Verkündung des Urteils nichts als ohrenbetäubendes Schweigen zu hören. Dabei liegt hier der Ursprung und zugleich auch die eindeutige Lösung für die rechtswidrigen Arbeitsbedingungen in der Leiharbeit.
Denn Schuld an den schlechten Löhnen in der Leiharbeit – im Schnitt verdienen Leiharbeitskräfte mehr als 1.400 Euro (41 Prozent) weniger als der Durchschnitt aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, zwei Drittel von ihnen bekommen gar einen Lohn unterhalb der Niedriglohnschwelle – sind vor allem die sogenannten tarifdispositiven Regeln im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz(AÜG), dem Gesetz, das die Bedingungen der Ver- und Entleihung von Beschäftigten regelt. In diesem Gesetz ist zwar festgeschrieben, dass die Leiharbeitsbeschäftigten ab dem ersten Tag ein Recht auf den gleichen Lohn und die gleichen Arbeitsbedingungen wie die direkt vom jeweiligen Unternehmen angestellten Arbeitskräfte haben.
Niedriglohn für Leiharbeit: Die Hartz-SPD hat das ermöglicht
Allerdings hatte der Gesetzgeber bereits im Rahmen der Hartz-Gesetze 2003 festgelegt, dass mit Tarifvertrag vom Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ abgewichen und weniger bezahlt werden darf. Diese Möglichkeit der Abweichung von den gesetzlichen Mindeststandards nach unten wurde bei der erneuten Reform des Gesetzes im Jahr 2017 zusätzlich auf die Höchstüberlassungsdauer ausgeweitet – also auf die Zeit, die Leiharbeitsbeschäftigte maximal an ein Unternehmen entliehen werden dürfen, bevor sie festangestellt werden müssen. Ziel war, damit die Attraktivität von Tarifverträgen zu steigern für die Arbeitgeber und so die Tarifbindung zu erhöhen. Für die Beschäftigten wurde das Prinzip „besser mit Tarifvertrag“ dadurch allerdings auf den Kopf gestellt.
Das SPD-geführte Arbeitsministerium feiert sich bis heute dafür, so die Tarifbindung in der Leiharbeit erhöht zu haben. Diese Selbstbeweihräucherung zeigt einmal mehr, dass für die SPD offensichtlich die Konzerninteressen der Profitmaximierung und des Lohndumping über den Interessen der arbeitenden Klasse stehen. Würde es die SPD mit der sozialen Gerechtigkeit ernst meinen, hätte sie schon längst feststellen müssen, dass die Einführung der tariflichen Öffnungsklauseln für die betroffenen Beschäftigten verheerend sind: Sie wurden zur Verhandlungsmasse zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden degradiert, frei nach der Logik „Bessere Arbeitsbedingungen für die Festangestellten, dafür hohe Flexibilität und niedrige Löhne bei den (zumeist unorganisierten) Leiharbeitsbeschäftigten“. So sind nun zwar 98 Prozent der Beschäftigten in der Leiharbeit von der Geltung eines Tarifvertrags betroffen. Statt für bessere Arbeitsbedingungen sorgen diese Tarifverträge jedoch für Niedriglöhne und dafür, dass die gesetzlich festgeschriebene Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten in den meisten Branchen deutlich ausgeweitet wurde.
Statt der eigentlich im Gesetz vorgesehenen 1,5 Jahre darf ein Leiharbeitsbeschäftigter in der Metall- und Elektroindustrie per Tarifvertrag so ganz legal 4 Jahre am Stück von ein und demselben Betrieb entliehen werden, ohne in eine Festanstellung übernommen zu werden. Und die Krisen der letzten Jahre haben gezeigt, dass es stets die Leiharbeitskräfte sind, die als Erstes gehen müssen, wenn die Profite der Unternehmen in Gefahr geraten. Noch deutlicher wird die Absurdität der tariflichen Öffnungsklauseln am Beispiel der Branchentarife für Kreditinstitute und das private Versicherungsgewerbe, wo eine Höchstüberlassungsdauer von bis zu 45 Jahren (!) gilt.
Die Behebung wird verzögert: mit fadenscheiniger Begründung
Mit den tariflichen Öffnungsklauseln führt das – seit 2002 fast durchgängig SPD-geführte – Arbeitsministerium ad absurdum, wofür Tarifverträge eigentlich da sind und wofür wir starke Gewerkschaften im Land brauchen. Nämlich um gute Arbeitsbedingungen zu gewährleisten und höhere Löhne durchzusetzen.
Wenn es sich bei den im Koalitionsvertrag getroffenen Aussagen zur gerechten Entlohnung und zu Respekt und Anerkennung für jede Arbeit um mehr als nur hohle Phrasen handeln soll, muss die Bundesregierung die Gelegenheit nutzen und den verfehlten Kurs bei der Leiharbeit korrigieren. Doch anstatt die tarifdispositiven Regeln abzuschaffen, spielt man lieber auf Zeit: Auf Anfrage teilte uns die Bundesregierung während der Sitzungswochen im Januar mit, man wolle nun noch das Urteil des Bundesarbeitsgerichts zum Fall der ursprünglich klagenden Leiharbeiterin abwarten, bevor man entscheiden könne, ob man das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz anrühre. Dabei ist die richtige Auslegung des Gleichstellungsgrundsatzes mit dem Urteil des EuGH bereits eindeutig klargestellt. Das Urteil des Arbeitsgerichts wird daran nichts mehr ändern.
Diese Verzögerungstaktik der Bundesregierung ist nichts Neues, wenn es um den Schutz und die Rechte der Beschäftigten geht. So hat die Bundesregierung auch beinahe vier Jahre nach dem Urteil des EuGH zur Arbeitszeiterfassung immer noch kein Gesetz auf den Weg gebracht, das diese Rechtsprechung umsetzt. Eine ähnliche Verzögerungstaktik zugunsten von Arbeitgebern und Konzernen und zulasten der betroffenen Beschäftigten droht nun auch im Fall der Leiharbeit. Die Bundesregierung verweist dreist darauf, dass die betroffenen Beschäftigten ja individuell gegen eine bestehende Schlechterstellung klagen können. Doch das entbehrt jeglichen Realitätssinns und deckt den Betroffenen in der aktuellen Krise auch nicht den Tisch. Als ehemalig praktizierender Anwalt für Arbeitsrecht sollte Olaf Scholz es eigentlich besser wissen: Aus Angst vor Konsequenzen klagen Beschäftigte so gut wie nie aus bestehenden Arbeitsverhältnissen, darüber hinaus ziehen sich Verfahren häufig über Monate und sind für Betroffene mit unüberschaubaren finanziellen Risiken behaftet. Vom im Wahlkampf viel beschworenen „Respekt“ vor der Leistung der Menschen, mit dem Scholz geworben hat, ist da keine Spur mehr.
Das Einzige, was den Beschäftigten in der Leiharbeit wirklich hilft und Rechtssicherheit schafft, ist, die tarifdispositiven Regeln unmittelbar aus dem Leiharbeitsgesetz zu streichen und so Gleichbehandlung herzustellen. Ein Ende der Zwei-Klassen-Belegschaften in den Betrieben stärkt dabei auch die Gewerkschaften und schafft den nötigen Rückhalt für gute Tarifverträge für alle Beschäftigten. Tarifverträge müssen auch weiterhin der Garant für gute Arbeit in diesem Land bleiben und dürfen in der Leiharbeit kein Einfallstor für Lohndumping sein.
Susanne Ferschl ist bayerische Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE im Bundestag.